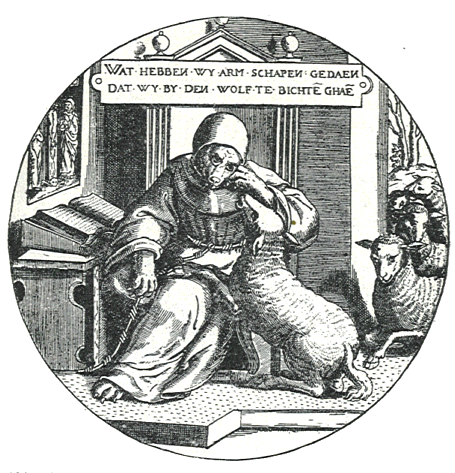
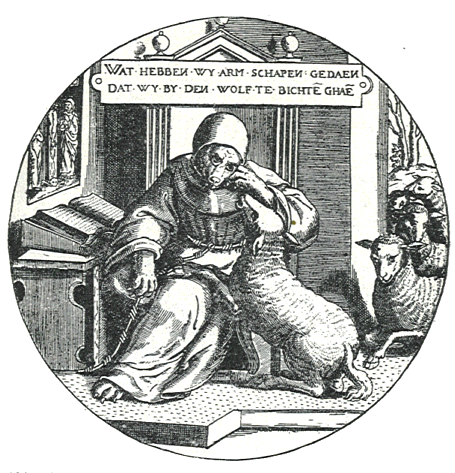
Der Theologe Nr. 55, aktualisiert am 24.1.2025
Bereits nach
wenigen Tagen greift die Kirche nach einem neuen Erdenbürger und verlangt von
seinen Eltern die Säuglingstaufe
(siehe dazu Der Theologe Nr. 40)
– unter Androhung der ewigen Verdammnis bei Nichtbefolgung, denn die Eltern
würden ihr Kind nach kirchlicher Lehre dann angeblich daran "hindern", zu
Christus zu kommen
(Katholischer Katechismus Nr. 1261) – eine
Verhöhnung von Jesus, dem Christus, denn Christus hat mit dem kirchlichen
Taufsakrament nichts zu tun.
Das durch
die Taufe in die Institution Kirche hinein gezwungene Kleinkind bleibt nun in der
Folgezeit einige Jahre von weiteren kirchlichen Praktiken verschont. Doch spätestens als etwa
acht- oder neunjähriges Schulkind wird der junge von seinen Eltern ohne seine
Zustimmung zum Katholiken gemachte Erdenbürger mit einer für ein kindliches
Gemüt besonders merkwürdigen und für seine Seele oft verheerend wirkenden Praktik der Kirche
konfrontiert: der Ohrenbeichte. Als Vorbereitung auf die "heilige
Erstkommunion" soll diese zum ersten Mal abgelegt werden, zur Vorbereitung
auf die so genannte "Firmung" (die Taufbestätigung) einige Jahre später erneut.
Nach dem kirchlichen Glauben werden die Menschen durch Pfarrer oder Priester von
ihren
Sünden los gesprochen. Das ist aber nicht möglich.
Jesus hat nicht gewollt, dass Seine Nachfolger überhaupt Theologen, Priester oder
Pfarrer werden, geschweige denn, dass diese angeblich Sünden vergeben
können. Doch was geschieht dann bei diesen kirchlichen Handlungen?
Darum geht es in diese Ausgabe des Theologen.
Gemälde oben:
Die katholische Beichte (um 1600) (aus: Die Kirche in der
Karikatur: eine Sammlung antiklerikaler Karikaturen, Volkslieder, Sprichwörter
und Anekdoten. Berlin – Der Freidenker, 1927)
Ein Beispiel, wie Menschen durch ein
Abhängigkeitsverhältnis zu einem "Beichtvater" in ihrer Persönlichkeit schweren
Schaden erleiden können, bis hin zur Entmündigung und einem frühen Tod, lesen Sie auch in der Ausgabe
Elisabeth von Thüringen und ihr
Beichtvater Konrad von Marburg.

Katholisch erzogene Kinder beichten im
Sinne der Religion also erstmals im Grundschulalter.
Lutherisch
erzogene Kinder kommen mit der Kirchenbeichte erst etwas später in Berührung,
mit ca. 13 Jahren, vor der Konfirmation. Und sie müssen dieses Beichtritual auch nicht
alleine mit einem Priester im Beichtstuhl
durchführen, sondern dürfen es
in der Gruppe sozusagen "pauschal" durchlaufen. Merkwürdig ist es aber für
Kinder allemal, dass sie sich – meist aus einem so genannten "Beichtspiegel" – ihre "Sünden"
quasi heraussuchen müssen, um dann von einem Menschen "Vergebung" zu erhalten, der
mit den herausgesuchten "Taten" in der Regel gar nichts zu tun hatte.
Hier beginnt bei vielen Kindern eine folgenschwere Verbiegung ihres Gewissens:
Um den Priester nicht zu enttäuschen, um es also möglichst "gut" zu machen, "erfinden"
katholische Kinder oftmals "Sünden" – der Beichtspiegel gibt genügend Anregung
–, die sie dann im Beichtstuhl (siehe rechts) möglichst zerknirscht vortragen. Anschließend
sprechen sie erleichtert oft einige Vaterunser-Gebete, die ihnen dafür als "Buße"
vom Priester auferlegt werden.
Doch was haben sie "gelernt"? Dass man (fast) alles tun kann – Hauptsache, ein
Priester bzw. Pfarrer erfährt es und verleiht dafür die so genannte "Absolution",
verstanden als Lossprechung bzw. Befreiung davon. Ob man sich mit seinem Nächsten versöhnt hat, ob man einen
Schaden wieder gutgemacht hat, ist zweitrangig, obwohl es in einem Erdenleben
für die Seele darauf ankommt. Und: Man muss sich dafür nicht
unbedingt ändern,
man darf immer wieder sündigen – dafür gibt es ja schließlich immer wieder
das so genannte Beichtsakrament! Der
Philosoph Friedrich Nietzsche spottete über dieses so genannte Sakrament:
"Man lispelt mit dem Mündchen, man knickst und geht hinaus – und mit dem neuen
Sündchen löscht man das alte aus."
In diesem Beichtstuhl sitzt der katholische Priester. Der Gläubige kniet sich rechts auf die Vorrichtung und spricht dem Priester, den er nicht sieht, ins Ohr.
Ein ganz
wichtiges Element im Leben eines jeden Menschen, nämlich die Unterscheidung
zwischen Gut und Böse und die Erforschung und Schulung des eigenen Gewissens,
wird auf diese Weise von Kindesbeinen bereits getrübt.
Bei vielen Kindern führt der Unterricht zur Vorbereitung auf die Erstkommunion
(erster Empfang der Oblate bzw. Hostie) und später das "Kirchensakrament" der Firmung (der
Taufbestätigung) auch zu schweren geistigen
Schäden. Vor allem, wenn sie glauben, was ihnen der Pfarrer von der angeblichen
Hölle und den kirchlich Verdammten erzählt, zu denen z. B. der "Verräter" Judas gehören
soll. Labile Kinder erblicken in dem Priester mit der angeblich "rettenden Hostie"
dann eine Art "väterlichen Retter", den sie verehren und zu Gefallen sein
möchten, was in Einzelfällen bis hin zu hündischem Gehorsam gehen kann. Dieses
Abhängigkeitsverhältnis wurde bereits von Tausenden von pädophilen Priestern
ausgenützt, um bestimmte Kinder dann zu Sex-Sklaven zu machen bzw. sie zum angeblich
"Gott gefälligen" Sex mit dem Würdenträger zu verführen. Die daraus folgende
Traumatisierung für das Kind oder den Jugendlichen dauert oft das ganze Leben
an, da der Priester dann eben nicht nur ein gewöhnlicher Sex-Verbrecher war oder ist,
sondern dem Opfer auch als Vertreter "Gottes" gilt (siehe dazu
Der Theologe Nr. 125).
Tatsächlich dient ihm das beim Beichtsakrament angewandte rituelle
Instrumentarium über seine begangenen Verbrechen z. B. an Kindern hinaus zu
einer schweren seelischen Manipulation der Menschen.
"Die Beichte ist ein Sakrament, das unter der krankhaften
Sexbesessenheit derer, die sie abnehmen, leidet." |
Im Vaterunser, das den Kirchgängern so häufig nach einer Beichte als so
genanntes "Bußgebet"
auferlegt wird, klingt noch an, was die ursprünglich christliche Lehre ist:
"Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern."
Der wahre Kern dieser Bitte ist:
Gott vergibt den Menschen ihre Schuld, wenn die aneinander schuldig
Gewordenen sich auch gegenseitig vergeben. Ein Priester ist dazu nicht
nötig und hat damit auch überhaupt nichts zu tun. Das heißt im
Umkehrschluss positiv: "Vergebt, und ihr werdet Vergebung erlangen." Und das bedeutet
auch: "Wenn ihr um Vergebung bittet und euch euer Nächster vergibt, so hat euch
auch euer Vater im Himmel vergeben". Erlangt der Schuldige jedoch noch
keine Vergebung von dem, den er geschädigt hat, kann auch die Vergebung Gottes
noch nicht erfolgen, denn auch im Nächsten, im Opfer einer sündigen Tat, ist
Gott gegenwärtig, der allerdings bei dem Geschädigten alles in die Wege leitet,
damit dieser bei einer ehrlichen Reue und Bitte um Vergebung des Täters diesem
auch vergibt (mehr dazu siehe hier). Damit wären auch die Priester nicht mehr über alles Denken und Tun ihrer
"Schäfchen" informiert und könnten mit einem auf diese Weise erlangten Wissen auch keine Macht
und keine manipulative Kontrolle mehr
ausüben.
|
|
Ein weiteres Beispiel:
Auch zahllose Hugenotten in Frankreich wurden aufgrund des katholischen
Beichtsakraments vernichtet. In dem berühmten Schreiben des Jesuiten-Priesters Père La
Chaise, dem Beichtvater von König Ludwig XIV. von Frankreich, schreibt der
Jesuit, wie er den König dazu brachte, das Edikt von Nantes, das seit 1598 den
protestantischen Hugenotten in Frankreich die Tolerierung gewährte, zu widerrufen. Der
Beichtvater wörtlich: "Als ich
ihn zu Beichte hatte, warf ich ihm die Hölle an den Kopf und ließ ihn seufzen,
sich fürchten und zittern, bevor ich ihm die Absolution erteilte." Bei
diesem Vorgehen sagte der Beichtvater, dass es einer "guten Tat" des
Königs bedürfe, um für seine Sünden zu büßen. Der Jesuit wörtlich weiter:
"Daraufhin fragte er mich schließlich, was er tun müsste. Ich sagte ihm, dass er
alle Ketzer aus seinem Königreich ausrotten müsste" (zit. nach Hislop, Von
Babylon nach Rom, S. 136 f.). Und König Ludwig XIV. gehorchte dem
Befehl seines Seelsorgers und hob am 18.10.1685 das Edikt von Nantes
wieder auf. Alle Hugenotten wurden dabei über Nacht aller religiösen und
bürgerlichen Rechte beraubt, und die meisten konnten sich vor ihrer drohenden Ermordung
durch die Flucht in die Niederlande, die Schweiz oder nach Preußen retten.
Auch im Dreißigjährigen Krieg waren es die katholischen Priester, die als
Beichtväter von Königen und Feldherren wirkten und die mithilfe von Beichte und
Buße die Menschen in Krieg und Vernichtung trieben.
Als Beispiel sie hier der Jesuitenpater Wilhelm Lamormaini genannt, der
Beichtvater von Kaiser Ferdinand II. (1578-1637), ein brutaler und kompromissloser
Kriegstreiber, der aus dem Beichtstuhl heraus so viel Macht auf den Kaiser
ausübte, dass der Priester Lamormaini als "eigentlicher
Gestalter der Politik galt" (Wikipedia,
Stand: 18.8.2011). Auch die Entlassung des Feldherrn Wallenstein, der sich
im Dreißigjährigen Krieg vielfach um einen Friedensschluss bemühte, wurde dem Kaiser
Ferdinand II. möglicherweise im
Beichtstuhl befohlen.
Die Kirche hatte also in allen den Jahrhunderten auch das
politische und juristische Sagen. Kaiser, Könige und Fürsten waren
oftmals nur die Marionetten ihrer Beichtväter und deren verlängertem Arm in Rom.
Und zur Erinnerung: Auf die Entlassung Wallensteins folgte 1634 bekanntlich
seine Ermordung wegen angeblichen Hochverrats.
Und dies ist noch lange nicht vorbei. Bis in unsere Zeit hinein existierte und
existiert eine kirchliche
Parallel-Welt neben den vordergründigen staatlichen Rechtssystemen.
Als Kardinal Joseph Ratzinger im Jahr 2001 die
absolute innerkirchliche
päpstliche Geheimhaltungspflicht bei Kinderschänderverbrechen von
Priestern bei Androhung von Höllenstrafen erneuerte, da unterstrich er einmal
mehr die Existenz dieser eigenen kirchlichen Parallelwelt mit einem eigenen weltweiten
Rechtssystem, das sich bis heute weigert, sich den staatlichen Rechten
und Gesetzen unterzuordnen. Zwar sind die "päpstliche Geheimhaltungspflicht" und
das kirchliche "Beichtgeheimnis" formal zweierlei, doch entstammen sie der
gleichen Quelle, und sie können auch kombiniert werden. Die "päpstliche
Geheimhaltungspflicht" ist ein Schweigegebot bei Verbrechen von Priestern, das
"Beichtgeheimnis" ist das Schweigegebot für jeden Priester gegenüber den
Inhalten, die er bei den Kirchenbeichten von Gläubigen hört.
Beides ist jedoch verknüpft, wenn zum Beispiel ein krimineller Priester sein Verbrechen
nicht in einem Gespräch mit seinem Vorgesetzten zugibt, sondern wenn er es
diesem bei der Sakramentsdurchführung in der Beichte sozusagen "beichtet". Dann wird dem Vorgesetzten
innerkirchlich sogar doppelt der Mund verschlossen: einmal durch die päpstliche
Geheimhaltungspflicht und dann durch das "Beichtgeheimnis".
In der aktuellen Diskussion argumentieren die Kirchenführer dann auch öfter mit
dem "Beichtgeheimnis" als mit der "Geheimhaltungspflicht",
welche 2019 schließlich
gelockert
wurde, nachdem sie sich zunehmend zum gesellschaftlichen Skandal entwickelt
hatte.
Ersteres genießt bei
religionsgeprägten Menschen aber noch den
Hauch von etwas Wichtigem, was gewahrt werden müsse.
So wird das "Beichtgeheimnis" dafür instrumentalisiert, die kirchlichen Gesetze
gegenüber den staatlichen überzuordnen, indem die Kirche behauptet: Was zwischen
Täter, Priester und angeblich "Gott" geschehe, muss vor dem Staat verborgen
gehalten werden. Das heißt: Alles, was nach kirchlicher Ansicht unter das
"Beichtgeheimnis" fällt bzw. was aus kirchlichem Interesse gezielt dort hinein
geheimnist wird, gilt für Polizei, Staatsanwälte und Richter als tabu und ist
allenfalls Bestandteil innerkirchlicher Kommunikationen. Und solange man der
Kirche diese Sonderrechte belässt, sind das Mittelalter und seine unmittelbaren Folgen noch immer nicht vorbei.
Jesus
lehrte im Gegensatz zur katholischen Beichtlehre
die Vergebung der Menschen untereinander. Im Vaterunser heißt es
dazu: "Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern." Und in der Bergpredigt mahnt Jesus eindringlich zur Aussöhnung
mit dem Nächsten, der mit einem auf dem Weg ist,
weil wir sonst für unsere Schuld bezahlen müssen
(Matthäus 5, 23-26).
Priester oder Pfarrer braucht es dafür nicht. Doch im Gegensatz
dazu ist nach kirchlicher Lehre ein Priester oder Pfarrer notwendig, der im
Namen Gottes angeblich vergeben könne. Ob sich die
Menschen untereinander vergeben, ist für den kirchlichen Kult
nicht entscheidend. Vergebung und Um-Vergebung-Bitten ist nicht mehr, wie
bei Jesus, eine Sache zwischen den Menschen, sondern ein kultisches
Geschehen zwischen Menschen, Priestern und der in der Kirche verehrten Gottheit
bzw. dem dort angebeteten Götzen.
Und mit dem
Sakrament der Beichte bzw.
der Ohrenbeichte hat der Priester wie in
früheren Jahrhunderten weiterhin ein
Machtinstrument gegenüber den Gläubigen in seinen Händen, das ihm das
Recht verleiht, sozusagen bis in die "hintersten Schlafzimmerwinkel" der
Gläubigen einzudringen und dieses Wissen gegebenenfalls auch im Interesse
der Kirche nützen zu können.
Bis heute leiden erwachsene Menschen,
die ansonsten sprichwörtlich "voll im Leben stehen", an der Deformierung ihres Gewissens durch die
kirchlichen Beichtlehren. So berichtete ein
ehemaliger Katholik, er habe sich geschämt, dem Priester die wirklichen
Sünden zu beichten, weil er den Priester ja als Mensch kannte und ihm
niemals solches anvertrauen würde. Gleichzeitig litt er aber daran, dass er
dem Priester wesentliche Sünden verschwieg, denn nun fürchtete er sich,
keine wirkliche Vergebung zu bekommen. An diesem Konflikt und diesem Dilemma
wäre fast sein Leben zerbrochen, bis er der Kirche den Rücken gekehrt hatte
und allmählich auch von diesen seelischen Belastungen frei wurde.
Als Rechtfertigung der Ohrenbeichte dient den Kirchen
vor allem eine Stelle des Neuen
Testaments im Johannesevangelium: "Wessen Sünden ihr nachgelassen habt, denen sind sie
nachgelassen; wessen ihr sie behalten habt, denen sind sie behalten"
(Johannes 20, 21-23). Einige Übersetzer halten die Stelle für dem Sinn nach
allerdings falsch übersetzt,
denn man könnte den beabsichtigten Inhalt gemäß dem Gesetz von Saat und Ernte auch so verstehen: "Wenn ihr Sünden nachgelassen
habt, dann werden sie auch euch selbst nachgelassen; wenn ihr sie behaltet, dann
werden sie auch euch selbst behalten." Also: Wie ihr mit anderen umgeht, so
wird auch mit euch umgegangen, also ein Aspekt des Gesetzes von Saat und
Ernte. Diese mögliche Deutung ist dann vergleichbar der Bitte
im Vaterunser, wo es heißt: "Und vergib´ uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern." Das heißt: Wir bitten um Vergebung,
da auch wir unsererseits vergeben.
Doch selbst wenn man voraus setzt, dass die von den Kirchen verwendete oben
zunächst genannte Übersetzung
des Bibelwortes im Johannesevangelium den Sinn
besser treffen würde, dann ist auch für diesen Fall nicht von Priestern und einer Kirche die Rede.
Die Worte sollte dann nämlich jeder auf sich beziehen, und die Bedeutung ist dann
folgende: Wenn
ich dem Nächsten, der sich an mir versündigte, die Sünden "nachlasse", das
heißt
vergebe, sind sie faktisch nachgelassen. Wenn nicht, bleibt die Schuld weiter an ihm haften.
Oder darüber hinaus: Es bedarf der Vergebung dessen, der durch die "Sünden"
geschädigt wurden, dann sind sie auch vor Gott getilgt bzw. "nachgelassen",
wenn der Täter sie nicht wiederholt.
Bei dieser Deutung gelangt man wieder zurück zur ursprünglichen Lehre von Jesus, wonach die
Vergebung der Sünden in erster Linie ein Vorgang zwischen den betroffenen Menschen selbst ist.
Das Ohr eines sündigen Priesters braucht es dafür nicht und schon gar nicht
seine Anmaßung, eine "Absolution" aussprechen zu können. Sondern das
versöhnungsbereite Herz aller Beteiligten ist entscheidend – ohne Priester und Kirche.
Die Kirche jedoch behauptet, Jesus habe ihnen, den Kirchenmännern, "befohlen", den Menschen die
Beichte abzunehmen. Doch es gibt keinen Auftrag oder Befehl
des Jesus von Nazareth an eine Kirche, so zu handeln. Worauf sich die Kirchen beziehen,
ist eine von ihr so genannte "Schlüsselgewalt", die ihr gemäß
ihrer eigenen Lehre
angeblich von Jesus
verliehen worden sei. Als Grundlage für diese Lehre werden die Worte von Jesus an Petrus im
kirchlichen Sinne verbogen. Die Worte lauten: "Ich
will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; alles, was du auf Erden binden wirst, soll
auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im
Himmel los sein" (Matthäus 16, 19).
Was Jesus hier dem Petrus sagte, ist aber eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, die jeder
für sein Leben anwenden kann, so eben auch Petrus, und die Jesus jedem anderen auch
hätte sagen können. Und genau das hat Er ja auch getan.
So heißt es im Matthäusevangelium einige Zeilen weiter
in allgemeiner Form: "Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel
gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein" (18, 18).
Hier ist weder von Priestern die Rede noch von einer Kirche, auch von
Petrus nicht mehr, sondern Jesus spricht vom Gesetz von Saat und
Ernte, und mit dem Wort "Himmel" ist in diesem Fall
dem Sinn nach das Jenseits gemeint.
Die Worte von Jesus erklären
den Sinn der Lebensschule Erde und dass sich das
diesseitige Leben im
Jenseits fortsetzt: Die Menschen, die sich auf der Erde von
etwas abhängig machen, sich also an etwas "binden", sich
also Lasten auferlegen, die sie unfrei machen, werden auch als Seelen im Jenseits
abhängig und an die entsprechenden
Lasten gebunden bleiben und damit weiter unfrei sein. Was aber auf der Erde gelöst, also bereinigt wird, davon
wird der Mensch auch als Seele im Jenseits frei sein.
Hier geht es um die innere
Freiheit: Alle Schuld und alle Belastungen, die auf der Erde
durch Reue, Vergebung und Wiedergutmachung gelöst werden, werden die Seele auch
im Jenseits nicht mehr belasten. Es ist gelöst, es ist "vergessen", und die Betroffenen sind
diesbezüglich wieder frei. Das ist die Bedeutung des
Jesuswortes. Das Gesetz von Saat und Ernte erfährt also durch den Tod des Menschen keine
Unterbrechung. Das Leben geht weiter, und eventuell mündet es in eine oder viele neue
Inkarnationen.
In Matthäus 16, 19 spricht Jesus
also davon, dass dieses "Lösen" von Abhängigkeit und Schuld auf der Erde der
"Schlüssel des Himmelreichs"
ist. Nicht der Tod schließt einem Menschen demnach den Himmel auf. Der Tod gibt dem Menschen nichts und er nimmt ihm
nichts. Es geht für die Seele im Jenseits an der Stelle weiter, an dem
das Leben im Diesseits beendet wurde, nur eben ohne materiellen Körper (vgl. Der Theologe Nr. 2 über den urchristlichen Glauben an
Reinkarnation). Die Kirche verbiegt also diese Stelle zum eigenen
Nutzen. Und sie
unterschlägt, dass Jesus mit dem Wort in Matthäus 18 alle
Christen angesprochen hat. Sie greift nur die Parallelstelle in
Matthäus 16, 19 heraus, wo Jesus diese Gesetzmäßigkeit beispielhaft
seinem Jünger Petrus erklärt. Dann konstruiert sich die Kirche selbst
als angebliche "Nachfolgerin" des Petrus und phantasiert
weiter, mit diesem
Satz hätte Jesus der Kirche als der angeblichen Nachfolgerin des Petrus eine "Schlüsselgewalt"
verliehen. Und diese so genannte Schlüsselgewalt dürfen wiederum – wie
in allen heidnischen Kulten – ausschließlich die Priester im "Sakrament
der Beichte" ausüben. Alles das ist eine massive Irreführung der
Menschen, womit sie weiter an ihre Sündenschuld und deren negative Folgen
gebunden werden. Es ist Missbrauch, nichts als Missbrauch des guten
Namens von Christus und eine Verhöhnung Seiner Person.
Noch der kirchenheilig gesprochene Kirchenvater Hieronymus (+ 419) lehnte deshalb das
heutige kirchliche Beichtsakrament mit klaren Worten ab:
"Die Priester maßen sich etwas vom
Hochmut der Pharisäer an, dass sie entweder die Unschuldigen
verdammen oder die Schuldigen freizusprechen meinen. Vor Gott wird
aber nicht nach dem Urteil des Priesters, sondern nach dem Leben des
Schuldigen gefragt."
(Hieronymus zu Mt. 16,19; T VII. 1. p. 124 ed. Valarsi)
Doch die Kirche vertraut darauf, dass die Leute zu dumm
sind, um das kirchliche Lügengebäude zu durchschauen und dass sie aus
Unkenntnis auf die kirchlichen Manipulationen hereinfallen. So ist
nicht einmal sicher, dass Petrus überhaupt in Rom war. Und das angebliche
Petrusgrab unter dem Petersdom ist bereits als Legende entlarvt. In Wirklichkeit
war dort eine Opferstätte des mithräischen Baalskultes, an dem Stiere
geschlachtet wurden. Doch selbst wenn die Petrusknochen dort echt wären, würde
das die Betrügereien kaum mindern.
Und diese Irreführungen hat die Kirche dann in ihren Dogmen und Lehraussagen noch
weiter ausgebaut.
Katholische und evangelische Beichte und der Ablass
Die Beichte zählt also zu den wesentlichen vermeintlichen "Rettungsangeboten" der Kirchen,
weil sie die Sündenvergebung bewirken soll.
Sie wird als eine angeblich von Jesus eingesetzte kirchliche Handlung
betrachtet, in der Gott wirken soll, ein so genanntes "Sakrament". Die
katholische Kirche lehrt sieben Sakramente. Neben ihrer Beichte noch die
Säuglingstaufe, die Eucharistie (das Abendmahl), die Firmung (die
Taufbestätigung), die letzte Ölung, die Priesterweihe und die Ehe. Die
Lutherischen lehren demgegenüber nur zwei "Sakramente", die Säuglingstaufe
und das Abendmahl.
der Gott wirken soll, ein so genanntes "Sakrament". Die
katholische Kirche lehrt sieben Sakramente. Neben ihrer Beichte noch die
Säuglingstaufe, die Eucharistie (das Abendmahl), die Firmung (die
Taufbestätigung), die letzte Ölung, die Priesterweihe und die Ehe. Die
Lutherischen lehren demgegenüber nur zwei "Sakramente", die Säuglingstaufe
und das Abendmahl.
Beichtstuhl: Dahinter wartet der katholische Priester auf den Gläubigen. (Bild: Antaya; Creative Commons Lizenz)
In der katholischen Kirche gibt es die Formulierung "Dieser selbe Gott vergebe
durch mich Sünder", gemeint ist der Priester. Das Wort "Sünder"
klingt demütig, doch was steckt hinter der Formulierung? Und welches Bild ergibt
sich, wenn man den Ablass einbezieht? Der Ablass gilt als der
"Erlass einer
zeitlichen Strafe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon getilgt
sind" (Katechismus der Katholischen Kirche, München 1993, Nr. 1471). Hinter
diesen Worten verbirgt sich zunächst die kirchliche Theorie, dass eine Schuld bereits durch
das von der Kirche durchgeführte "Bußsakrament" getilgt sei.
Die nächste Frage wäre dann aber, wie mit möglichen Nachwirkungen der Schuld
umgegangen werden soll. Auch hier spricht sich die Kirche die
Verfügungsvollmacht zu, indem sie vorgibt, aus dem "Schatz der Genugtuung
Christi und der Heiligen" über den Erlass oder Teilerlass für
"zeitliche
Sündenstrafen" "autoritativ"
verfügen zu können. Dies geschieht "unter genau bestimmten Bedingungen"
und sei sogar für Verstorbene im Jenseits möglich, deren Läuterungsweg dadurch
verkürzt würde.
Das kirchliche Tun beim "Bußsakrament" bekommt zusätzliches Gewicht dadurch,
dass es heißt, es sei "nach wie vor der einzige
[!] ordentliche Weg der Versöhnung mit Gott und
der Kirche, wenn ein solches Sündenbekenntnis nicht physisch oder moralisch
unmöglich ist". (Ordo poenitentiae 31, Katechismus Nr. 1484)
Bei diesem Thema wie auch bei vielen anderen nennen die Amtskirchen "Gott" und
"Kirche" in einem Atemzug, was eine Vereinnahmung und
ein grober Missbrauch des Namens Gottes ist, letztlich eine Verhöhnung Gottes.
Die Entstehung der evangelischen Kirche begann im 16.
Jahrhundert mit dem Kampf gegen den Ablass der katholischen Kirche.
Was ist aus dieser Auseinandersetzung um die
"Buße" geworden? In der evangelischen Kirche
toleriert man heute den Ablass, was
man z. B. an Reaktionen auf den katholischen Jubiläumsablass im Jahr 2000 sah,
wo ein evangelisch-lutherischer Bischof mit feierlicher Miene daneben stand, als der Papst
diesen Ablass "erteilte". Und auch in der
evangelischen Kirche blieb ja der geistige Vollmachtsanspruch der Pfarrer auf
diesem Gebiet erhalten, wie im Folgenden dargelegt wird.
Und hier ein
Originaldokument der evangelisch-lutherischen Kirche zur Beichte aus dem Lehrwerk
Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, herausgegeben
im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930, 9. Auflage, Göttingen 1982.
Zwar betrachtet die evangelische Kirche die Beichte nicht wie die Katholiken
als ein angeblich von Jesus eingesetztes "Sakrament", doch hält sie an dem
falschen Anspruch der Pfarrer und Priester, angeblich Sünden vergeben zu
können, fest. Nachfolgender Lehrsatz aus diesem Werk ist für evangelisch-lutherische
Kirchenmitglieder verbindlicher Glaube, und jeder Pfarrer wird darauf
vereidigt.
Confessio Augustana, Artikel 12 –
"Von der Buße wird gelehrt, dass diejenigen, die nach
der Taufe gesündigt haben, jederzeit, wenn sie Buße tun, Vergebung der
Sünden erlangen und ihnen die Absolution von der Kirche nicht verweigert
werden soll ... [Es]
werden die verworfen [= ewig verdammt],
die nicht lehren, dass man durch den Glauben Vergebung der Sünden erlangt,
sondern durch unsere Genugtuung."
Anmerkung: Wer also sein Vergehen direkt mit dem
Menschen in Ordnung bringt, an dem er schuldig geworden ist und nicht in
die Kirche oder zum Pfarrer in die Beichte geht, wird nach evangelischer
Lehre ewig verdammt. Um dieser Höchststrafe zu entgehen, bräuchte er
nämlich auch nach dieser Lehre den richtigen Glauben und die "Absolution" durch einen Pfarrer.
Mehrmals im Jahr habe ich als evangelischer Pfarrer zum Beispiel eine
so genannte "Gemeinsamen Beichte" verantwortlich geleitet. Dabei geschieht
folgendes:
Zunächst betet der Pfarrer laut einige vorbereitende Worte, die in die Frage
an die Anwesenden mündeten: "Vor dem heiligen Gott frage ich einen jeden von euch:
Bekennst du, dass du schuldig geworden bist, und bereust du deine Schuld? Begehrst du die
Vergebung deiner Schuld im Namen Jesu Christi? Glaubst du auch, dass die Vergebung, die
ich dir zuspreche, Gottes Vergebung ist, so antworte: Ja."
Die Teilnehmer antworten laut mit "Ja", woraufhin der Pfarrer
fortsetzt: "Wie ihr glaubt, so geschehe euch. In Kraft des Befehls, den der Herr
seiner Kirche gegeben hat, spreche ich euch frei, ledig und los: Euch ist eure Schuld
vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes."
Die Teilnehmer antworteten "Amen" und der Pfarrer sagt darauf
hin: "Gehet
hin in Frieden!"
Bei den Absolutionsworten nach einer katholische oder evangelischen Beichte
soll es also Gott sein, der durch den Pfarrer vergibt. Und der Beichtende soll der Sünde fortan
"abgestorben" sein, wie es
manchmal heißt. Was natürlich nicht funktioniert, weil die Ursachen
bzw. Wurzeln der "Sünde" weiter wirken und den Menschen bei nächster Gelegenheit wieder
zu entsprechendem oder ähnlichem Handeln veranlassen.
Ein Pfarrer bittet die Beichtenden nachträglich um Vergebung
Als ehemaliger evangelischer Pfarrer habe ich
also einst selbst den Menschen die "Beichten" abgenommen. Später
habe ich diese Menschen in Gedanken um Verzeihung gebeten, die an den von
mir einst als Pfarrer verantworteten "Beichten" teilgenommen
haben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich damals in der
falschen Sicherheit wogen, es sei dadurch etwas vergeben worden, was in
Wirklichkeit noch nicht vergeben war.
Dazu ein Beispiel: Nehmen wir an, jemand empfindet Schuldgefühle seinem von ihm geschiedenen Ehepartner
gegenüber. Beide gehen nun getrennte Wege, doch vieles aus der Vergangenheit ist nicht
aufgearbeitet, eventuell überlagern Vorwürfe an den anderen die volle Erkenntnis der
eigenen Schuld. Mit gemischten Gefühlen nimmt der Mensch jetzt an der "Gemeinsamen
Beichte" in der evangelischen Kirche teil. Ihm wurde nicht gelehrt, dass eine Schuld z. B. erst vergeben sein kann,
wenn auch der an dieser Schuld Leidende dem Betreffenden vergibt. Davon ist der ehemalige
Partner aber eventuell noch weit entfernt.
Bei der evangelischen Beichte spricht der Pfarrer im Namen Gottes nun den einen
"frei, ledig und los". Dieser glaubt vielleicht daran und betrachtet die Angelegenheit
damit als bereinigt. Mögliche spätere Gewissensbisse bringt er in sich zum Schweigen, auch
eventuell tiefer gehende Empfindungen über seinen Anteil Schuld. Ihm sei ja
angeblich von "Gott"
vergeben worden. Möglicherweise wurde ihm vom Pfarrer in einem Einzelgespräch sogar noch
nachdrücklich empfohlen, einfach fester zu glauben, dass ihm vergeben sei, um
seiner Gewissensbisse Herr zu werden.
In der Zwischenzeit gerät
sein ehemaliger Partner immer mehr auf die schiefe Bahn und setzt weitere negative
Ursachen, die in seinem Leben weitere negative Wirkungen nach sich ziehen. Und in seinen Gedanken und Gefühlen macht jener immer heftiger seinen früheren
Partner dafür verantwortlich, dessen Schuld ja scheinbar vergeben worden ist. Kann dieser
nun sagen: "Ich habe mit dem heutigen Leben des ehemaligen Partners nichts mehr zu tun,
denn mir ist vergeben worden, für mich ist die Sache in Ordnung"? In der Bergpredigt
spricht Jesus von einer ähnlichen Situation und sagt: "Darum: Wenn du deine Gabe
auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit
deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe" (Matthäus 5, 23 f.).
Sinngemäß heißt das: Wenn du dich Gott zuwenden willst und du spürst, dass es in
der Beziehung zu einem Menschen nicht stimmt, dann gehe zu diesem Menschen und
bringe das Verhältnis in Ordnung. Und hier ist auch von Bedeutung: Auch in
deinem Mitmenschen ist Gott gegenwärtig. Oder, was ebenfalls daraus folgt: Wenn
du gegen einen deiner Mitmenschen eingestellt bist, dann bist du auch gegen
Gott.
Theologen kommen nicht so schnell in den Himmel
Beichtgeheimnis = Verbrechensgeheimnis abschaffen
Am Ende
setzte sich die Kirche auch hier faktisch durch. Zwar wurde im Jahr 2012 die
Ausnahme, im Falle eines so genannten "Beichtgeheimnisses" Kindsmissbrauch
nicht polizeilich anzeigen zu müssen, offiziell abgeschafft. Doch ist bis
in die Gegenwart anscheinend kein Gerichtsverfahren bekannt geworden, in welchem dies zur Anwendung
gekommen wäre.
Wie ist die
Rechtslage in anderen Ländern? In den USA und in
Frankreich gibt es beispielsweise eine "Anzeigepflicht" von Sexualverbrechen an Kindern
bei der Polizei. In Deutschland ist dies weiterhin noch nicht der Fall, was im Zusammenhang mit dem
Beichtgeheimnis dazu führt, dass der Rechtsstaat untergraben
wird.
Aus diesem Grund
haben die Freien Christen die katholischen Bischöfe aufgefordert, von sich
aus ihren Einfluss in der Politik geltend zu machen, um auch in Deutschland
eine solche Anzeigenpflicht einzuführen.
Doch einstweilen dominiert in Deutschland weiterhin die päpstliche
Geheimhaltungspflicht in Verbindung mit dem "Beichtgeheimnis", das
vielfach auch
ein "Verbrechensgeheimnis" ist. Und dieses Verbrechensgeheimnis wird
erst seit dem Jahr 2010 zunehmend gelüftet, weil nun immer mehr Opfer sich
getrauen, ihr Schweigen zu brechen. Und immer mehr Menschen
erkennen auch, dass die sündigen Priester niemals im Namen Gottes "vergeben" und
"lossprechen" können, sondern dass sie in der Regel weit mehr als viele andere selbst der
Vergebung ihrer Opfer bedürfen. Doch eben nicht einer "Scheinvergebung" durch ein kirchliches
Sakrament, die es in Wahrheit gar nicht gibt, sondern die Vergebung der Geschädigten selbst. Diese werden aber
nur in den
seltensten Fällen dazu bereit sein, solange die Priester nicht echte Reue zeigen
anstatt sich zu beschweren, wenn sie massiv angeklagt werden. Und solange
sie nicht bereit sind, umfangreiche Wiedergutmachungen zu leisten anstatt
nur ein Taschengeld anzubieten.
Doch indem sie
von den Opfern vielfach "Barmherzigkeit" für sich einfordern, versuchen manche
Täter und Täteranwälte, den Opfern erneut ein schlechtes Gewissen einzureden. Früher, indem man
ihnen drohte, nichts zu erzählen, heute, indem man sie ermahnt, sie
müssten barmherziger sein.
|
|
Startseite mit
Inhaltsverzeichnis
Impressum
E-Mail an info@theologe.de
Datenschutzerklärung
Die Zeitschriften
DER THEOLOGE,
Ausgaben Nr. 3, 8, 70, 100 und 119
sind kostenlos
auch in
gedruckter Form erhältlich. Ebenfalls das Heft
Freie Christen Nr.
1.
Dazu einfach eine
E-Mail
an info@theologe.de
mit Ihrer Postadresse senden und die gewünschten Hefte anfordern.
Über eine finanzielle Unterstützung
freuen wir uns natürlich: IBAN:
DE06 6739 0000 0002 0058 08 bei der Volksbank Main-Tauber, BIC: GENODE61WTH,
Kontoinhaber: Dieter Potzel, Verwendungszweck: "Der Theologe".
Vielen herzlichen Dank!
Leider wurden die Seiten von der Suchmaschine Google in den letzten
Jahren abgewertet und ihre
Auffindbarkeit auf diesem Weg erschwert. Bei anderen Suchmaschinen
sind die Seiten vielfach deutlich besser platziert. Möchten Sie die
Verbreitung der Inhalte des
"Theologen"
im Internet
fördern, dann setzen Sie einfach einen
Link
zu unserer Hauptseite oder zu anderen Seiten.