DER THEOLOGE –
Warum diese Internetseite: Rehabilitation von Christus
Intellektuelle,
Machtmenschen und Priester: Die Entstehung der Kirche
Der so genannte
"Frühkatholizismus
"Tod den Urchristen und anderen Nichtkatholiken"
Franziskaner, Dominikaner und
der Versuch, das Urchristentum nachzuahmen
Der hintergründige Sinn der
Reformation
Freikirchen und Ökumene
Aufklärung
"Tretet aus von ihr, Mein Volk!"
Intellektuelle, Machtmenschen und Priester:
Die Entstehung der Kirche
Die Nachfolger von Jesus bildeten urchristliche Gemeinschaften. Doch viele,
die sich dort "Christen" nannten, orientierten sich überwiegend an
anderen Menschen, die sich entsprechend hervor taten, anstatt an der Lehre
von Jesus von Nazareth und anstatt bei Christus und Gott in ihrem Inneren
Halt zu finden in dem
Sinne, wie es Jesus von Nazareth lehrte: "Das Reich Gottes ist in
euch". Anstatt also mit Hilfe der
inneren Gotteskraft immer konsequenter nach den Geboten Gottes zu leben und
auch in der Seele zu erstarken, erlaubte
man sich
zunehmend
Nachlässigkeiten, Leichtfertigkeiten und ließ immer mehr Kompromisse zu. Und weil
die Menschen deshalb zu wenig in Christus und in Seiner Botschaft verwurzelt waren und zu wenig
im Inneren verbunden mit Gott, dem All-Geist in allem Sein, entstanden
auch Uneinigkeiten darüber, was nun in konkreten Situationen richtig und was falsch
sei. So wurde der lebendige "Gottesgeist", der die
ersten
Nachfolger von Jesus in ihrem Inneren und in der Gemeinschaft noch führte,
durch intellektuell geprägte Meinungsbildner und durch nach persönlicher
Macht strebende Menschen immer
mehr unterdrückt. Und bei der Auseinandersetzung über den richtigen Weg bekamen
hierarchische Strukturen, religiöse Formen, Zeremonien und äußere Regeln und Vereinbarungen ein
immer größeres Gewicht. Durch diese Entwicklung wurden die urchristlichen Gemeinschaften
zunächst erheblich geschwächt.
Als verhängnisvoll erwies sich hierbei vor allem der
Schriftgelehrte und ehemalige Pharisäer Saulus, später
Paulus genannt, der
aufgrund seiner eigenen bis dahin unaufgearbeiteten charakterlichen
Machtbestrebungen – zusammenfassend formuliert – Gemeinschaften des selbstlosen Dienens in
Herrschafts-Gemeinschaften umprägte. Die Apostel, die als Jünger von Jesus
von Nazareth noch von diesem selbst geschult worden waren, leisteten zwar
erheblichen Widerstand, doch während dieser Konflikte trat nicht nur der
"Geist Gottes" durch das Prophetische Wort immer mehr in den Hintergrund.
Auch die bedingungslose Gottes- und Nächstenliebe ging zurück. Doch es war
und ist Paulus, der für diese allmähliche Zerstörung der ersten Urgemeinden
die Hauptverantwortung trug.
Stattdessen wuchs nun parallel dazu unter den Nachfolgern des Paulus etwas
heran, was sich mehr und mehr als Gegensatz zu Jesus von Nazareth erwies.
Das einst dynamische und lebendige Urchristentum wurde bald nur noch in
kleinen Gruppen außerhalb dieser sich heraus bildenden Kirche gelebt. Unter
den Paulus-Nachfolgern hatten stattdessen stark auf ihr
Ego bezogene Personen das Sagen, und es entstand dort eine immer straffere
Hierarchie, ein Oben und ein Unten.
Gab es in den Urgemeinden "Gemeinde-Ältesten"
(die so genannten "Presbyter"), die dort ihre Leitungs-Aufgabe einzig aufgrund ihrer
inneren Autorität und ihrem Gehorsam gegenüber der Lehre Jesu ausüben sollten,
wurden in dem neuen Gebilde Priester
und Bischöfe fest installiert. Und diese "Posten" behielten sie dort
auch dann, wenn sie von ihrer Lebensweise nicht mehr für eine
Gemeindeleitung geeignet waren, hielten also an ihrer einmal erlangten Macht
und ihrem Einfluss fest. Ähnliches war auch in anderen Kulten der
damaligen Zeit üblich. Jesus von Nazareth
hat niemals eine solche Institution gewollt.
Doch diese neuen institutionellen Gebilde beriefen sich, wie einst die
früheren Urgemeinden, auf Ihn, den Christus Gottes, dem dies ein Gräuel
gewesen wäre.
Dies sind die Geburtsstunden der Kirche bereits im Laufe des 1. Jahrhunderts, in der
Wissenschaft heute "Frühkatholizismus" genannt.
Der so genannte "Frühkatholizismus"
Nach der faktischen Trennung vom gelebten Urchristentum wurden in der
frühkatholischen Bewegung die Institutionalisierungen immer weiter
ausgebaut. Aus anfangs noch untergeordneten Äußerlichkeiten und Symbolen wurden verbindliche Vorschriften und
am Ende gar unumstößliche Dogmen und "Sakramente". Und
diese wurden
eben nicht nur als rituelle
Symbolhandlungen verstanden, sondern als vermeintlich reale
heilsnotwendige Religionshandlungen, die nur Priester und Bischöfe wirksam vollziehen
könnten. Dazu bedienten sich die
Bischöfe und Priester immer mehr solcher "Traditionen", gegen die einst schon die
Propheten des Alten Testaments und Jesus von Nazareth angekämpft hatten,
z.
B.
grausame Tierschlachtungen, sowie weiterer Lehren und Praktiken aus den
antiken Götzen-, Herrscher-
und Blut-Kulten und ihrer "Vielgötterei", z. B. den Baal- und dem Mithraskulten.
Es schien, als hätte man in diese Religionssysteme dann Reste der Botschaft von Jesus von
Nazareth mit eingebaut, um dadurch den Anspruch zu begründen, das neue
Religionssystem würde Seine Lehre vertreten und verwirklichen. Doch was sich
hier entwickelte, erschien manchmal so, als hätten sich frühere Baalspriester nur einen
anderen Mantel übergestreift, einen angeblich "christlichen", um
nun
mit diesem neuem Mantel weiterhin die alten Götzenkulte zu zelebrieren. Dies beschreibt den
Frühkatholizismus und baldigen Katholizismus am treffendsten. Die alten Baalspriester waren dort, erst
unmerklich und später immer unverhüllter, wieder auferstanden.
Während man in der Frühform der Kirche einerseits die Überbleibsel der
früheren "heidnischen" Kulte als "Konkurrenz"
bekämpfte, übernahm man andererseits also die dort über lange Zeit üblichen Vorstellungen und Praktiken und
baute sie zu eigenen nun kirchlichen Lehrgebäuden, Sakramenten und "gottesdienstlichen"
Handlungen um. Auf diese Weise formte sich im 2., im 3. und
im 4. Jahrhundert eine machtvolle neue (so genannte "synkretistische")
totalitäre
Mischreligion, die römisch-katholische Kirche.
Der Baalkult hatte, wenn
man es so sehen möchte, auf
diese Weise also in
den damaligen Umbruchszeiten überlebt und ist damit als äußerer Sieger
aus den vielfältigen Religions-Auseinandersetzungen hervor gegangen, nur eben unter
anderem Namen. Und dafür verwenden seine Priester und Amtsträger bis heute ausgerechnet den Namen
ihres größten Gegners, Jesus von Nazareth. Diabolischer hätte man dieses
neue Religionsgebilde
nicht konstruieren können.
Wer hingegen Jesus, dem Christus, tatsächlich nachfolgen wollte, hatte dort keinen Platz mehr,
was Jahr für Jahr offensichtlicher wurde. Die katholische Kirche stieg
schließlich im 4. Jahrhundert zur einzigen Staatsreligion des
Römischen Reiches auf und wurde nach der Völkerwanderung praktisch zur
Nachfolgerin des antiken Imperium Romanum. Der alte "Pontifex maximus" des
antiken Rom war nun wieder der neue "Pontifex maximus", jetzt in einem katholischen
Gewand, beginnend mit dem damals neuen Imperator Papst Leo I., der Große. Er
und die kommenden Anführer des Katholizismus übernahmen mit dem Titel "Pontifex maximus"
also auch die Herrschafts-Symbolik der Mörder von Jesus von Nazareth, und sie stellten
sich damit faktisch in deren Nachfolge, in die Nachfolge dieses mörderischen
Herrschaftssystems. Doch
diese neue, aber in ihrem Kern alte Götzen-Religion zeigte in allen Epochen
seither auch ihr wahres Gesicht.
Und wer etwas reformieren
wollte, riskierte mehr und mehr sein irdisches Leben. Denn das "System"
hat sich zur mächtigsten Gegenspielerin
der freien Nachfolger von Christus
etabliert.
Mehr zu diesem Thema in "Freie Christen Nr. 1":
Bischof statt Christus
– Anfänge der römisch-katholischen Kirche.
Der Schlachtruf des
Katholizismus:
"Tod den Urchristen und anderen Nichtkatholiken"
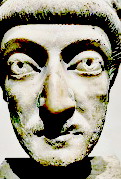 Gleich zu Beginn ihrer staatlichen
Etablierung seit Kaiser Konstantin und nach Einführung des ebenfalls aus
heidnischen Kulten entlehnten Dreieinigkeitsdogmas im Jahr 325 ließ die römisch-katholische Kirche ihre Kritiker enteignen (ab dem Jahr 326).
So beschlagnahmte die Obrigkeit gemäß dem so genannten "Häretikergesetz" von
Kaiser Konstantin z. B. Häuser, in denen sich Menschen versammelt
hatten, die in kleinen Gruppen wie
in der Zeit des Urchristentums leben wollten, und die Obrigkeit "schenkte" die
beschlagnahmten Häuser und Wohnungen der
schon damals so genannten "katholischen Kirche". Gleich zu Beginn ihrer staatlichen
Etablierung seit Kaiser Konstantin und nach Einführung des ebenfalls aus
heidnischen Kulten entlehnten Dreieinigkeitsdogmas im Jahr 325 ließ die römisch-katholische Kirche ihre Kritiker enteignen (ab dem Jahr 326).
So beschlagnahmte die Obrigkeit gemäß dem so genannten "Häretikergesetz" von
Kaiser Konstantin z. B. Häuser, in denen sich Menschen versammelt
hatten, die in kleinen Gruppen wie
in der Zeit des Urchristentums leben wollten, und die Obrigkeit "schenkte" die
beschlagnahmten Häuser und Wohnungen der
schon damals so genannten "katholischen Kirche".
Im Jahr 380 wurde unter Kaiser Theodosius I. "dem Großen"
(Foto links)
dann die
Todesstrafe für Nichtkatholiken eingeführt, was vor allem ab dem
Mittelalter im Laufe von Jahrhunderten
Hunderttausenden, ja, einschließlich von Kriegen, Millionen von Menschen das Leben kostete.
Das Vermögen Hingerichteter wurde ebenfalls meist der Kirche übereignet – ein Grundstock für
ihren bis heute
unermesslichen Reichtum. Die antiken heidnischen Götzen- und
Baalskulte
wurden von der Kirche mit der Zeit im Äußeren ganz vernichtet. Im Inneren
jedoch hat die katholische Großinstitution faktisch deren Nachfolge angetreten.
Für die
bisherigen Anhänger der meist totalitären früheren religiösen Kulte war es dabei nicht schwer, sich in
der neuen katholischen Staatsreligion zurecht zu finden. Denn bis auf das "christliche" "Mäntelchen",
das man jetzt zur Täuschung noch mit überziehen musste, hatte sich wenig geändert. Im
Imperium hat also im Kern nur ein raffinierter Gewändertausch stattgefunden, die Inhalte
blieben letztlich ähnlich wie in antiken Götzenkulten.
Und die Kirche gründet ihre Macht dabei bis heute auf eine Hierarchie von Priestern, Theologen
und Juristen in Verbindung mit der Staatsmacht. Als geistige Grundlage schuf man dazu
auf Konzilen und Kirchenversammlungen immer mehr Dogmen
und verbindliche Lehrmeinungen, in die man hier und da weiterhin, wie
bereits erprobt, einige Restbestände aus dem
Schatz des Urchristentums mit
einfließen ließ, damit diese verhängnisvolle und üble Vereinnahmung auch begründet werden konnte und
damit die Irreführung der Menschen auch auf längere Zeiten in die Zukunft
hinein gelingt.
Franziskaner, Dominikaner und der Versuch,
das
Urchristentum nachzuahmen
Auf diese Weise haben die Gegner von Jesus Seine
Botschaft praktisch vereinnahmt und verunstaltet, anstatt zu versuchen, sie
in
offener Konfrontation zu vernichten. Wer jedoch wirklich Christ sein
wollte, konnte folglich früher oder später kein Mitglied der Kirche
mehr sein, und hier reagierte die neue Macht des Imperium Romanum mit
äußerster Grausamkeit: Mit Folter,
Mord
 und Hinrichtungen versuchte man seither immer wieder, die Urchristen,
die sich nicht der kirchlichen und Hinrichtungen versuchte man seither immer wieder, die Urchristen,
die sich nicht der kirchlichen Machthierarchie unterordneten, auszurotten.
Und um sich dafür in der Bevölkerung einen gewissen Rückhalt zu verschaffen,
probierte man parallel dazu, das in der Bevölkerung anerkannte Tun der
Urchristen nachzuahmen und auf diese Weise
in die Kirche zu integrieren.
Machthierarchie unterordneten, auszurotten.
Und um sich dafür in der Bevölkerung einen gewissen Rückhalt zu verschaffen,
probierte man parallel dazu, das in der Bevölkerung anerkannte Tun der
Urchristen nachzuahmen und auf diese Weise
in die Kirche zu integrieren.
So wurden z. B. im 12.
Jahrhundert über viele Jahrzehnte hinweg die urchristlichen Katharer in
Frankreich ermordet und vernichtet, während die Kirche deren soziales
Engagement zu kopieren versuchte,
indem sie die Orden der Dominikaner oder Franziskaner ins Leben rief.
Gleichzeitig wurden innerhalb dieser Orden aber ganz bewusst die
Inquisitoren rekrutiert,
die dann meist "aus
der zweiten Reihe heraus" diejenigen mordeten,
diskriminierten und verfolgten,
die sie auf anderen Gebieten nachzuahmen versuchten.
Das
vermeintlich "Gute" in der Kirche wurde auf diese Weise in den vielen
Jahrhunderten immer auch in den Dienst der
kirchlichen Schreckensherrschaft gestellt.
In diesem Sinne hat man z. B. auch
Elisabeth von Thüringen verführt, der
eigenen Gewaltherrschaft unterworfen und nach ihrem frühen Tod zur
"Kirchenheiligen" gemacht. Und wer sich nicht verführen ließ und
standhaft blieb, erlitt meist den Foltertod wie die Gottesbotin
Marguerite Poréte in Frankreich.
Foto links oben @ Maryanne Bilham (USA) for Divine Eros: Die
Gottesprophetin Marguerite Poréte wurde 1310 in Paris auf dem Scheiterhaufen
lebendig verbrannt. Und die Kirche beauftragte den "heiligen"
Franziskaner Giovanni de Capistrano (Foto rechts oben), alle Exemplare ihrer Schrift
Spiegel der einfachen Seelen, der den Weg zu Gott im eigenen Herzen
aufzeigte (durch tätige Nächstenliebe und Überwindung des Ego),
zu vernichten.
Der
hintergründige Sinn der Reformation
Als der Betrug und der Verrat der römisch-katholischen Kirche an Jesus
von Nazareth in Mitteleuropa um das Jahr 1500 jedoch immer offensichtlicher
war, wurde das System einer obrigkeitlichen und gegen Christus
gerichteten Machtkirche durch die evangelische Reformation zunächst "gerettet". Es erfolgten dazu von den
"Reformatoren" einige Veränderungen und eine Neugestaltung der
Machtverhältnisse, und man ging dabei anfangs noch schroff gegen den Vatikan
vor. Dies war damals auch vielen Menschen sympathisch. Doch aufs Ganze
gesehen wirkte hierbei nicht Jesus, der Christus, sondern es wirkten Machtmenschen wie Martin Luther,
Huldreich Zwingli, Johannes Calvin sowie andere "Reformatoren" und ihre
Hintermänner. Diese wichen nur teilweise von den Überzeugungen der herrschenden Päpste, Kardinäle,
Bischöfe und kirchlichen Theologen ab (vgl. hier die
Lehre Martin Luthers) und blieben diesen in ihrem
gewalttätigen Wesen
ähnlich.
Diese "Reformatoren", die sich dank ihres Bündnisses mit
den mächtigen Fürsten und regionalen Herrschern gesellschaftlich
durchgesetzt haben, gaben zwar vor, die "christliche"
Lehre wiederherstellen zu wollen. Sie fälschten sie aber letztlich
nur auf andere Art, bis hin zu weiteren Verschlimmerungen.
Und über eine lange Zeit
standen sich seither dann zwei große religiöse Machtblöcke in Mitteleuropa in Kriegen gegenüber,
und
erneut mussten Hunderttausende von Menschen ihr Leben lassen – für den einen
Machtblock oder den anderen. Und wer die christliche Lehre wirklich wiederherstellen wollte wie z. B. Gruppen so genannter "Täufer" oder einzelne
Menschen freien Geistes, wurde nun auf Betreiben von zwei kirchlichen Staats-Machtblöcken
(dem katholischen und dem evangelischen)
grausam verfolgt, gefoltert und hingerichtet.
Freikirchen und Ökumene
Als auch der Betrug der evangelischen Obrigkeits-Institution von immer mehr
Menschen durchschaut
wurde, bildeten sich im 19. Jahrhundert innerhalb oder im Umfeld der
evangelischen Kirchen so genannte Erweckungsbewegungen und Freikirchen,
die dem starren und
eiskalten bürokratischen Protestantismus neues Leben einzuhauchen versuchten
– vergleichbar den
Dominikanern oder Franziskanern des Mittelalters, die den Katholizismus
erneuern sollten und gleichzeitig Andersdenkende massiv bekämpften. Das geschah
im Protestantismus, indem man
die kirchlichen Lehren ernster nahm und sich gleichzeitig z. B. sozial
engagierte, um so im Volk beliebter zu werden. Dieses Bemühen änderte jedoch nichts
daran, dass die Lehren zum großen Teil weiterhin im Gegensatz zu Jesus, dem
Christus, standen.
Die Entwicklung
seither führte bis in unsere heutige "Ökumene". In diesem Boot
sitzen neben der katholischen alle evangelischen Organisationen, die mit der
römisch-katholischen Kirche und dem Papst zusammen arbeiten bzw. von diesen
berechtigt werden, mit ihr zusammen arbeiten zu dürfen. Und auch
Gemeinschaften, deren Glieder früher von der Kirche ermordet wurden,
bemühen sich dabei – unter Preisgabe oder durch Verschweigen ihrer
Erkenntnisse – auf vielfache Art um die Gunst der Machtkirchen (z. B. heutige Baptisten, Mennoniten, Waldenser, Quäker). Und in neuester Zeit
bemühen sich auch die Neuapostolische Kirche und Teile der so genannten
Adventisten um Anerkennung durch das Gewalt-Imperium des
Katholizismus und den Machtblock ihrer Tochter-Organisation Protestantismus.
 Verbrennung der Waldenser im
Jahr 1215 in Straßburg durch die Romkirche (Gemälde von Jan Luiken,
1665). Im Jahr 2016 bekamen jedoch die Gruppierungen, die sich heute
"Waldenser" nennen, eine Audienz beim Papst. Damit lenkten sie
noch weiter ein auf
den Weg der Unterwerfung unter das "System Baal", wie es das katholische Dogma von ihnen
verlangt. Verbrennung der Waldenser im
Jahr 1215 in Straßburg durch die Romkirche (Gemälde von Jan Luiken,
1665). Im Jahr 2016 bekamen jedoch die Gruppierungen, die sich heute
"Waldenser" nennen, eine Audienz beim Papst. Damit lenkten sie
noch weiter ein auf
den Weg der Unterwerfung unter das "System Baal", wie es das katholische Dogma von ihnen
verlangt.
Durch diese Entwicklung wurde das Ziel dieser Mächte, Jesus durch Vereinnahmung
kalt stellen
zu können, einige weitere Jahrhunderte weiter intensiv verfolgt
– in Mittel-
und Westeuropa nun vor allem verteilt auf zwei Groß-Institutionen, die
katholische und die evangelische mit ihren vielen "Einzelkirchen"
und den so genannten Freikirchen am Randbereich der so genannten "Ökumene".
Hierzu gehören mehr oder weniger auch so genannte "evangelikale" oder "charismatische"
Gemeinschaften außerhalb oder innerhalb vor allem der evangelischen
Staatskirchenblöcke, die
für sich in Anspruch nehmen, die evangelische Lehre intensiver zu
praktizieren als dies innerhalb des institutionellen Haupt-Machtblocks getan
wird.
In unserer gegenwärtigen Umbruchszeit
[21. Jahrhundert] werden die vielen evangelischen Blend-Feuer von
ihrer inneren Kraft her jedoch immer schwächer. Sie zerstreiten sich oder sie vermischen sich
–
vergleichbar wie in der katholischen Kirche – mit
okkulten Praktiken
wie z. B. in Südamerika oder Afrika, was hier und da zu kurzfristigen
"Aufbrüchen" führen kann. Dies wird dann dem "Heiligen Geist" zugeschrieben.
Es handelt sich jedoch um Rest-Energien aus dem gegen Christus gerichteten evangelischen Energiefeld,
vermischt mit astral-okkulten Einflüssen aus den jenseitigen Bereichen.
Die Nachfolger der einstigen
"Reformatoren" sehnen sich heute dabei nach Anerkennung als
"richtige Kirche" durch ihre römisch-katholische Mutterkirche. Doch auch
diese ist im rasanten Niedergang begriffen, vor allem durch Hunderttausende von
Sexualverbrechen von Priestern an Kindern und deren gezielte Vertuschung und
Verharmlosung durch den katholischen Papst und die Kirchenhierarchie des
Vatikan, wobei offenbar erst die Spitze des
Eisbergs aufgedeckt ist.
Aufklärung
Die Zeitschrift Der Theologe ist dabei ausdrücklich nicht
gegen katholische und evangelische Mitbürger gerichtet – im Gegenteil. Sie
hilft jedoch mit, den Etikettenschwindel der Institutionen, die sich auf
Christus berufen, aufzudecken, und wir weisen auf Folgendes hin:
Das, was dort gelehrt und getan wird, ist
zwar
katholisch oder evangelisch, jedoch nicht christlich. Denn mit dem Urchristentum haben
beide Großkirchen und ihre Lehren nichts zu tun, und der Name "Christus"
wird deshalb von ihnen grob missbraucht.
Und selbst dort, wo die Worte hier und da mit Christus übereinstimmen, kann
man das Jesuswort bedenken: "Was sie sagen, das tut und haltet; aber nach ihren Werken
sollt ihr nicht handeln; denn sie sagen´s zwar, tun´s aber nicht ... Alle
ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden"
(Matthäus 23, 3.5) –
eine
Mahnung, die zwar allen Menschen gilt, aber schon von Jesus selbst
ausdrücklich an die Schriftgelehrten, an die damaligen Theologen, gerichtet war.
"Tretet aus von ihr, mein Volk"
In unserer Zeit gibt es natürlich auch unter den Kirchenmitgliedern
Menschen guten Willens, die sich ehrlich bemühen, in ihrem persönlichen
Leben nach den Zehn Geboten und der Lehre von Jesus von Nazareth zu leben,
die dem Willen Gottes entspricht, den Er uns nahe brachte.
Wenn sich diese jedoch nicht für das gegenteilige Ziel – der Vereinnahmung
und Verfälschung von Christus – missbrauchen lassen wollen, dann gilt für
sie der göttliche Aufruf durch den Propheten Johannes über die "Hure Babylon": "Tretet aus von ihr, mein Volk
[so eine korrekte mögliche Übersetzung], dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts
empfangt von ihren Plagen" (Offenbarung 18, 4). Hören die
Mitglieder des Kirchenvolks nicht auf die Gottesworte durch Prophetenmund
und bleiben sie Babylon treu,
haben sie eben weiterhin "teil an den Sünden" der Kirche und werden
früher oder später entsprechend
"empfangen"; so das Prophetenwort in den Bibeln.
Viele Menschen bleiben auch trotz besseren Wissens ein Blatt am "Stammbaum der Verbrechen", der seit ca.
1900 Jahren Kirchengeschichte ein Zeichen der Warnung und Mahnung für alle Menschen ist.
Denn die Kirchengeschichte zeigt an ihren "Früchten" ungeschönt auf, welche Mächte hier tatsächlich
am Wirken sind. Dabei handelt
es sich nicht nur um die nachweisbaren Verbrechen von Folter,
Morden und Kriegen, sondern auch um das Verbrechen, den Namen "Christus" zu
missbrauchen, um ganze Generationen von Menschen in die Irre zu führen
und sie um ihr Glück und um ein erfülltes Leben zu bringen, indem man die
gute Botschaft von Jesus zensiert, fälscht und im eigenen Kult- und Drohgebäude untergehen lässt.
Der Theologe
möchte also in erster Linie aufklären. Daneben wird hier und da aber auch versucht,
die
ursprünglichen Anliegen von Jesus von Nazareth wieder lebendig werden zu
lassen. Es geht uns in diesem Sinne um eine Rehabilitation von Jesus von
Nazareth, dem Christus.
Jesus lehrte in Seiner Bergpredigt z. B. Gewaltlosigkeit und Feindesliebe
und nicht den Einsatz von Waffengewalt als angeblich "letztes Mittel" wie die Kirchen
und auch wie meist die kirchenkritische "Theologie der Befreiung", die vor allem
in den 70er- und 80er- Jahren des 20. Jahrhunderts sehr weit verbreitet war.
So könnte man im modernen Wortgebrauch sagen: Jesus war Pazifist. Und unsere "theologische" Arbeit
könnte man dann z. B. auch als eine "Befreiungstheologie"
nach der Bergpredigt des Jesus von Nazareth bezeichnen. Denn die
Bergpredigt ist lebbar. Und sie ist die Hoffnung für diese Erde.
|
 DER THEOLOGE wird
von einem ehemaligen lutherischen Pfarrer
heraus gegeben,
DER THEOLOGE wird
von einem ehemaligen lutherischen Pfarrer
heraus gegeben,  Während katholische und evangelische Theologen aufgrund ihrer
Kirchenbindung Ergebnisse liefern müssen, die dem Dogma oder anderen
Glaubenszwängen und kirchlichen Glaubensmeinungen unterworfen sind,
weil sie sonst ihr kirchliches Lehramt verlieren, ist diese Seite unabhängig, nur der Wahrheit verpflichtet
und im Sinne einer Wissenschaft, für die "Treu und Redlichkeit" obenan
steht.
Während katholische und evangelische Theologen aufgrund ihrer
Kirchenbindung Ergebnisse liefern müssen, die dem Dogma oder anderen
Glaubenszwängen und kirchlichen Glaubensmeinungen unterworfen sind,
weil sie sonst ihr kirchliches Lehramt verlieren, ist diese Seite unabhängig, nur der Wahrheit verpflichtet
und im Sinne einer Wissenschaft, für die "Treu und Redlichkeit" obenan
steht.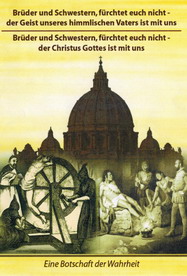
 Die
Broschüre (siehe rechts) ist auch als Druckschrift ebenfalls gratis erhältlich
in Deutsch
über
info@der-freie-geist.de.
Die
Broschüre (siehe rechts) ist auch als Druckschrift ebenfalls gratis erhältlich
in Deutsch
über
info@der-freie-geist.de. 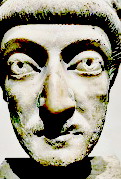 Gleich zu Beginn ihrer staatlichen
Etablierung seit Kaiser Konstantin und nach Einführung des ebenfalls aus
heidnischen Kulten entlehnten Dreieinigkeitsdogmas im Jahr 325 ließ die römisch-katholische Kirche ihre Kritiker enteignen (ab dem Jahr 326).
So beschlagnahmte die Obrigkeit gemäß dem so genannten "Häretikergesetz" von
Kaiser Konstantin z. B. Häuser, in denen sich Menschen versammelt
hatten, die in kleinen Gruppen wie
in der Zeit des Urchristentums leben wollten, und die Obrigkeit "schenkte" die
beschlagnahmten Häuser und Wohnungen der
schon damals so genannten "katholischen Kirche".
Gleich zu Beginn ihrer staatlichen
Etablierung seit Kaiser Konstantin und nach Einführung des ebenfalls aus
heidnischen Kulten entlehnten Dreieinigkeitsdogmas im Jahr 325 ließ die römisch-katholische Kirche ihre Kritiker enteignen (ab dem Jahr 326).
So beschlagnahmte die Obrigkeit gemäß dem so genannten "Häretikergesetz" von
Kaiser Konstantin z. B. Häuser, in denen sich Menschen versammelt
hatten, die in kleinen Gruppen wie
in der Zeit des Urchristentums leben wollten, und die Obrigkeit "schenkte" die
beschlagnahmten Häuser und Wohnungen der
schon damals so genannten "katholischen Kirche". und Hinrichtungen versuchte man seither immer wieder, die Urchristen,
die sich nicht der kirchlichen
und Hinrichtungen versuchte man seither immer wieder, die Urchristen,
die sich nicht der kirchlichen
 Verbrennung der Waldenser im
Jahr 1215 in Straßburg durch die Romkirche (Gemälde von Jan Luiken,
1665). Im Jahr 2016 bekamen jedoch die Gruppierungen, die sich heute
"Waldenser" nennen, eine Audienz beim Papst. Damit lenkten sie
noch weiter ein auf
den Weg der Unterwerfung unter das "System Baal", wie es das katholische Dogma von ihnen
verlangt.
Verbrennung der Waldenser im
Jahr 1215 in Straßburg durch die Romkirche (Gemälde von Jan Luiken,
1665). Im Jahr 2016 bekamen jedoch die Gruppierungen, die sich heute
"Waldenser" nennen, eine Audienz beim Papst. Damit lenkten sie
noch weiter ein auf
den Weg der Unterwerfung unter das "System Baal", wie es das katholische Dogma von ihnen
verlangt.